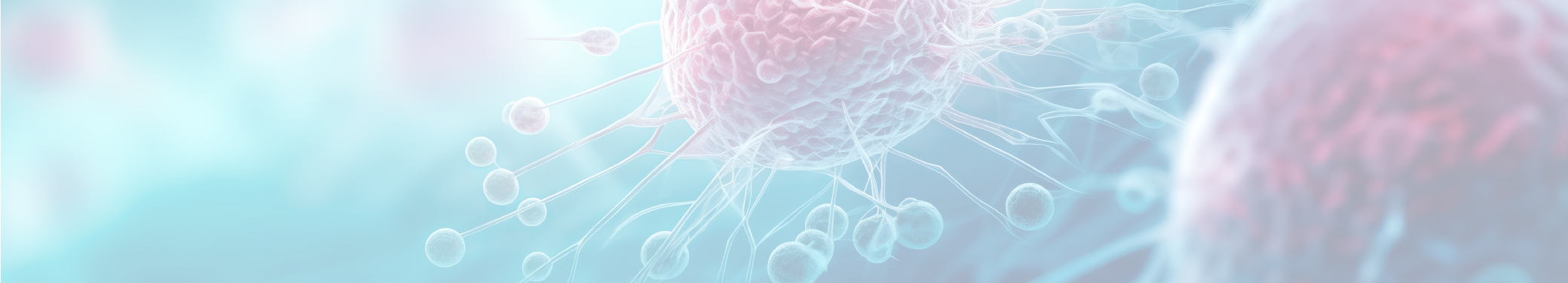Annemarie Graeff
hat die Stiftung in Gedenken an ihren Ehemann Prof. Dr. Henner Graeff im Jahr 2013 zur Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Krebsforschung gegründet.

Professor Dr. Henner Graeff
Klinischer und wissenschaftlicher Werdegang
Geboren am 19. April 1934 in Mannheim, studierte Henner Graeff in Heidelberg, Innsbruck und Berlin Humanmedizin. Nach seiner Promotion im Jahr 1959 (Dr. med.) begann er seine ärztliche Laufbahn als Medizinalassistent an der Medizinischen Klinik der Universität Heidelberg. Nach kurzzeitigen beruflichen Positionen am Institut für Hygiene und der Chirurgischen Klinik an der Universität Heidelberg, begann er seine Facharztausbildung an der Frauenklinik der Universität Heidelberg. 1969 erfolgte die Facharztanerkennung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie die Habilitation.
1967 startete Prof. Dr. Graeff seine wissenschaftliche Laufbahn als „Post-doctoral fellow“ mit einem NIH-Stipendium am Dept. für Geburtshilfe und Gynäkologie am University Medical Center in New York, USA in der Forschergruppe von Prof. Dr. F. K. Beller. Hier studierte er die Rolle von Endotoxinen bei der intravaskulären Blutgerinnung. Die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Forschungsarbeit wurden in hochrangigen wissenschaftlichen Journalen publiziert, unter ihnen das Journal Nature im Jahr 1967. Er folgte dann Prof. Dr. med. Josef Zander, der 1964 die Leitung der Frauenklinik des Klinikums der Universität Heidelberg übernommen hatte und 1970 an die Universitätsfrauenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München als Direktor berufen wurde, nach München und wurde in den 17 Jahren der Zusammenarbeit entscheidend durch das klinische und wissenschaftliche Wirken von Herrn Prof. Dr. Zander auf dem Gebiet der Translationalen Krebsforschung geprägt. Dies führte zu seiner Beteiligung an zwei Sonderforschungsbereichen (SFB) der LMU, dem SFB51 „Medizinische Molekularbiologie und Biochemie“ (1983–1990) und dem SFB207 „Grundlagen und klinische Bedeutung der extrazellulären limitierten Proteolyse“ (1991–1997), die durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurden. 1975 wurde Prof. Dr. Graeff zum apl.-Professor ernannt und führte 1978 zu seiner Berufung als C3-Professor. Er war in dieser Zeit als Leitender Oberarzt und Stellvertretender Direktor an der Frauenklinik tätig. 1982 wurde Prof. Dr. Graeff auf den Lehrstuhl für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an die TUM berufen, den er bis zu seiner Emeritierung im Herbst 2000 innehatte.
Wissenschaftlicher Fokus
Prof. Dr. Graeff war wissenschaftlich insbesonders auf dem Gebiet des Brust- und Eierstockkrebs im Hinblick auf die Translation grundlagenorientierter Forschung in die klinische Praxis hinein sehr erfolgreich. Seine Studien zur Rolle tumorassoziierter Proteasen bei der Krebsprogression und -metastasierung schufen die Basis für die Entwicklung neuer zielgerichteter Krebstherapeutika. Seine wissenschaftlichen Errungenschaften sind in mehr als 500 wissenschaftlichen Artikeln, die in international anerkannten und hochrangigen wissenschaftlichen Journalen publiziert wurden, dokumentiert. Seine beeindruckende wissenschaftliche Arbeit wurde in vielen Vorträgen auf internationalen Konferenzen und Workshops, die er in vielen Fällen auch selbst organisierte, einem breiten wissenschaftlichen Publikum dargestellt.
1992 initiierte die DFG in der von ihm geleiteten Frauenklinik am Klinikum rechts der Isar eine Klinische Forschergruppe (DFG #34), die erste ihrer Art, die schon sehr bald eine hohe internationale wissenschaftliche Reputation fand. Außerdem erhielt Prof. Dr. Graeff Forschungsmittel von vielen anderen (inter)nationalen Förderprogrammen, durch die Europäische Union, die Deutsche Krebshilfe, die Wilhelm Sander-Stiftung und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 1997 beteiligte sich Prof. Dr. Graeff an der Gründung der ersten Spin-off-Firma an der Medizinischen Fakultät der TUM, der Wilex AG in München.